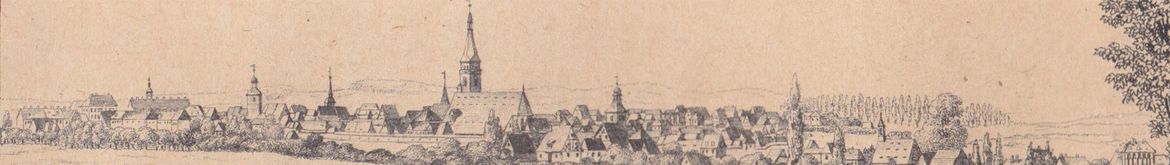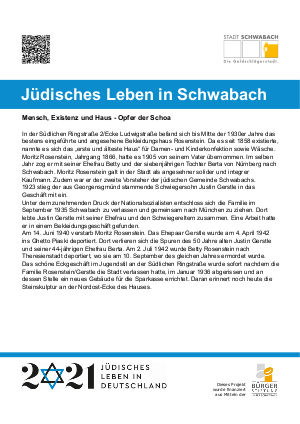In der Südlichen Ringstraße 2/Ecke Ludwigstraße befand sich noch in der Anfangszeit der 1930er Jahre des Nationalsozialismus das bestens eingeführte und angesehene Bekleidungshaus Rosenstein. Da es seit 1858 existierte, nannte es sich das „erste und älteste Haus“ für Damen- und Kinderkonfektion sowie Wäsche. Moritz Rosenstein, Jahrgang 1866, hatte es 1905 von seinem Vater übernommen. 1897 schloss er am 10. August in Nürnberg-Schweinau die Ehe mit der 28-jährigen Kaufmannstochter Betty Neumann aus Wassertrüdingen. Im Juli 1905 zog das Ehepaar mit ihrer siebenjährigen Tochter Berta von Nürnberg nach Schwabach. Moritz Rosenstein galt als solider und integrer Kaufmann, der in der Stadt sehr angesehen war. Zudem war er der zweite Vorsteher der kleinen jüdischen Schwabacher Gemeinde mit ihren 43 Mitgliedern bei rund 12.000 städtischen Gesamteinwohnern.
Am 15. Februar 1923 wurde die Hochzeit von Tochter Berta mit Justin Gerstle (geb. 1882) gefeiert. Er war der älteste der drei Gerstle-Brüder aus Georgensgmünd, der zuvor eine Zeit lang in München gewohnt hatte. Das frisch verheiratete Paar zog nach Schwabach, wo der Schwiegersohn zum Teilhaber des Geschäfts wurde.
Aufgrund der politischen Situation, nicht zuletzt durch die Einführung der Rassengesetze im März 1935 erlebte die Familie Rosenstein/Gerstle zunehmend den verordneten Boykott ihres Ladens. Auch die „Kartl-Runde“ mit Moritz Rosenstein wurde aus Angst nur noch in Privaträumen abgehalten, wobei Rosenstein, sich selbst nur traute, diese durch die Hintertür zu betreten. Die Familie spürte, dass der verordnete Hass existenziell war und gab ihren treuen Kunden zusätzlich viele Waren kostenlos mit, weil sie ahnten, das Geschäft aufgeben und die Stadt verlassen zu müssen. So entschlossen sie sich im September 1935, Schwabach zu verlassen und gemeinsam nach München zu ziehen. Dort lebte Justin Gerstle mit seiner Ehefrau (die Ehe blieb kinderlos) und den Schwiegereltern zusammen. Eine Arbeit hatte er in einem Bekleidungsgeschäft gefunden. Nachdem die Eltern Rosenstein im August 1939 in das Altenheim der Israelitischen Kultusgemeinde in der Kaulbachstraße umgezogen waren, verstarb fast ein Jahr später am 14. Juni 1940 Moritz Rosenstein. Damit blieb ihm die Schoa erspart. Anders verhielt es sich mit seiner Ehefrau Betty: Sie wurde aus dem Altenheim ausquartiert und kam wie ihre Tochter und ihr Schwiegersohn in das Barackenlager Knorrstraße in Milbertshofen. Dort aber blieb das Ehepaar Gerstle nicht lange, denn für den 4. April 1942 war ein Abtransport angekündigt. Diese Informationen wurden durch einen Brief bestätigt, den Justin Gerstle einen Tag vor der Abfahrt an seine uneheliche Tochter schrieb, die einer Verbindung zu einer Nichtjüdin entstammte und von der auch seine Ehefrau Bescheid wusste. Darin verabschieden sich nämlich Berta und Justin gemeinsam vor ihrer „Fahrt ins Blaue“, die aber ins menschenunwürdige Ghetto Piaski führte. Dort verloren sich die Spuren des damals 50 Jahre alten Justin und seiner 44-jährigen Berta. Ihre Mutter Betty wurde erst am 2. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 10. September des gleichen Jahres ermordet wurde.

| Das Geschäft der Familie Rosenstein/Gerstle an der Ecke Südliche Ringstraße/Ludwigstraße kurz vor der Schließung. An der Fassade ist ein Transparent zu sehen, das auf einen Totalausverkeuf hinweist. (Stadtarchiv Schwabach Fotos 1942B) |
Das schöne Eckhaus mit dem Geschäft im Jugendstil an der Südlichen Ringstraße wurde sofort nachdem die Familie Rosenstein/Gerstle die Stadt verlassen hatte, im Januar 1936 abgerissen. An dessen Stelle bauten die Architekten Friedrich Merz, Wiesner und Rogler ein neues Gebäude für die Sparkasse, das am 13. November 1936 Richtfest feierte. Daran erinnert noch heute die Steinskulptur an der Nordost-Wandecke des Hauses. Etliche Branchen waren hier im Laufe der Jahrzehnte in das Gebäude mit der großen Verkaufsfläche eingezogen, doch erst mit dem heutigen Eigentümer wurde wieder zur ursprünglichen Nutzung als Bekleidungsgeschäft zurückgekehrt.
Literatur:
Gerd Berghofer: Die Anderen- Das fränkische Georgensgmünd und seine Juden vor und während des Dritten Reiches; Treuchtlingen-Berlin 2013
Stadtarchiv Schwabach (Hrsg.): Gedenkbuch zur Judenverfolgung in Schwabach in der NS-Zeit, Schwabach 1999.