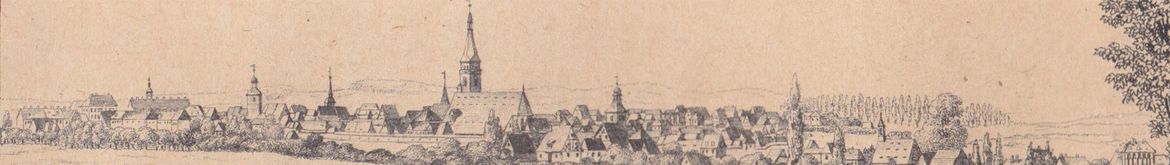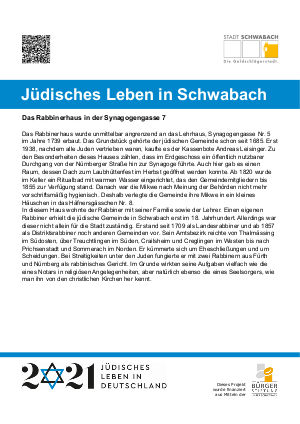
Erbaut wurde das Rabbinerhaus unmittelbar angrenzend an das Lehrhaus, Synagogengasse Nr. 5 im Jahre 1739. Das Grundstück gehörte der jüdischen Gemeinde schon seit 1685. Erst 1938, nachdem alle Juden aus Schwabach vertrieben waren, kaufte es der Kassenbote Andreas Leisinger. Zu den Besonderheiten dieses Hauses zählt, dass durch dieses Haus im Erdgeschoss ein öffentlich nutzbarer Durchgang von der Nürnberger Straße hin zur Synagoge führte. Auch hier gab es einen Raum, dessen Dach zum Laubhüttenfest im Herbst geöffnet werden konnte. Ab 1820 wurde im Keller ein Ritualbad mit warmen Wasser eingerichtet, das den Gemeindemitgliedern bis zur behördlichen Visitation von 1855 zur Verfügung stand. Denn ab diesem Zeitpunkt war die Mikwe nach Meinung der Behörden nicht mehr vorschriftsmäßig hygienisch. Deshalb verlegte die Gemeinde ihre Mikwe in ein kleines Häuschen in das Häfnersgässchen Nr. 8.
In diesem Haus Nr. 7 wohnte der Rabbiner mit seiner Familie sowie auch der Lehrer. Einen eigenen Rabbiner erhielt die jüdische Gemeinde in Schwabach erst im 18. Jahrhundert. Allerdings war dieser nicht allein für die Stadt zuständig. Er stand seit 1709 als Landesrabbiner und ab 1857 als Distriktsrabbiner auch anderen Gemeinden vor. Sein Amtsbezirk reichte von Thalmässing im Südosten, über Treuchtlingen im Süden, Crailsheim und Creglingen im Westen bis nach Prichsenstadt und Sommerach im Norden. Er kümmerte sich um Eheschließungen und um Scheidungen. Bei Streitigkeiten unter den Juden fungierte er mit zwei Rabbinern aus Fürth und Nürnberg als rabbinisches Gericht. Im Grunde wirkten seine Aufgaben vielfach wie die eines Notars in religiösen Angelegenheiten und jüdischen Stiftungen betreffend.
Zu den bemerkenswerten Rabbinern zählte der Vorfahre von Karl Marx. Dessen Ururgroßvater mütterlicherseits war Joschua Heschel Lemberger, der 1693 in Westhoffen im Elsass geboren war, überwiegend in Trier gelebt hatte und mit 56 Jahren nach Schwabach zog. Im Alter von 78 Jahren verstarb er in Schwabach 1771, beigesetzt wurde er im jüdischen Friedhof von Georgensgmünd, allerdings ist sein Grabstein nicht erhalten. Kurz vor seinem Ruf nach Schwabach war er von der deutschen Gemeinde in Amsterdam eingeladen worden, um dort Oberrabbiner zu werden. Er aber entschied sich für das Landrabbinat im Markgraftum Ansbach. Hoch angesehen in der jüdischen Welt wurde er auch noch im hohen Alter um seinen Rat gefragt. Er erhielt religiös-rechtliche Anfragen jüdischer Gemeinden aus dem gesamten Europa.
Ebenso interessant ist der streng orthodoxe Rabbiner Abraham Josef Wechsler, der 1796 in Schwabach als Sohn des Bettzeug- und Ellenwaren-Händlers David Hänlein Wechsler geboren wurde und ab 1848 in seiner Geburtsstadt amtierte. Aus dieser Familie Hähnlein-Wechsler ging neben ihm mit seinem Neffen Hyle Wechsler (1843-1894) noch ein weiterer Rabbiner hervor. Durch die Heirat mit der Tochter Caja des wohlhabendenden Kaufmanns Zacharias Brüll gelangte er 1820 zu Vermögen. Fünf Jahre später verstarb seine Frau 1825. Danach heiratete er ein zweites Mal. In dieser Ehe wurden zwölf Kinder geboren, allerdings blieben nur sechs am Leben. Erst 1848 erfüllte sich sein Wunsch, in Schwabach Rabbiner zu werden. Er erwies sich als außerordentlich strenger orthodoxer Rabbiner, für die Knaben einen Stundenplan mit 22 Stunden Religionsunterricht in der Woche vorsah, was aber von der Gemeinde abgelehnt wurde. In der Zeitung und in anderen Gemeinden wurde seine Haltung als rückwärtsgewandt angesehen. Kritisiert wurden seine Lehrbücher, die er verwenden wollte, weil die jedes Kind -ob arm oder reich – zu einem hohen Preis von 20 bzw. 25 Gulden zu erwerben hatte. Aber in Schwabach fand er insgesamt dennoch einen großen Rückhalt.
Ebenso namhaft war Löb Wissman, Rabbiner in Schwabach (1857-1887) und Leiter der Talmud Tora-Schule. Er wurde am 25. Oktober 1857 zum Distrikts-bzw. Bezirksrabbiner ernannt. Dieses Amt übte er bis zu seinem Ruhestand (aus gesundheitlichen Gründen) 1901 aus. Geboren war er in Wiesenbronn bei Kitzingen am 29. März 1830 . Er hatte die Jeschiwa (jüdisches Lehrhaus) in Höchberg und danach die Talmudhochschule des Nathan Wolf Lieber in Pressburg besucht, ehe er seine Ernennung in Schwabach erhielt. Gemeinsam mit Hyle Wechsler übernahm Wissman die Leitung der Talmud-Tora-Schule, wobei er sie mit ihren 20 Schülern als Präparandenschule führte, zur Vorbereitung auf den Eintritt in die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg. Er starb 1903 in Schwabach
Schließlich sollte auch noch Dr. Salomon Ma(n)nes, der letzte Rabbiner in Schwabach, erwähnt sein: 1901 kam er als Vertreter für den erkrankten Rabbiner Leo/Löb Wissmann in diese Gemeinde. Als Wissmann 1904 starb, wurde Ma(n)nes Distriktsrabbiner. Im gleichen Jahr heiratete er seine Frau Klara, die wie er aus Posen stammte. Als Rabbiner war er zuständig für bis zu neun jüdische Gemeinden, verwaltete Stiftungen und verteilte Almosen. Dazu leitete er das Schwabacher Talmud-Tora-Institut und unterrichtete am Adam-Kraft-Gymnasium. Zusammen mit dem Nürnberger Rabbiner Dr. Klein und dem Fürther Rabbiner Breslauer bildete er das rabbinische Gericht, das Bet Din, zuständig für innergemeindliche Streitigkeiten und Scheidungen. Auch seine Ehefrau Klara brachte sich in die Gemeinde ein. Nachdem ihre sieben Kinder größer waren, gründete sie 1924 den israelitischen Frauenverein und stand ihm auch als Vorsitzende vor.
1932 wurde er vordergründig wegen des zahlenmäßigen Rückgangs seiner Gemeinde in den Vorruhestand geschickt und drei Jahre später zog die Familie nach Frankfurt um. Dort kümmerte sich eine seiner Töchter um die Ausreise der Eltern über Rotterdam nach London. Dies klappte aber erst zum Jahresende. Deshalb musste er noch erleben, dass uniformierte Nazis in der Reichspogromnacht in seine Wohnung eindrangen und alles verwüsteten. Da er jedoch keinen Kommentar abgab, sondern nur laut betete, ließen ihn die Männer einfach stehen. Als nun seine Ausreise anstand, wollte das Ehepaar gar nicht so recht in den Zug nach Amsterdam steigen, weil ein Sohn noch im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war. Doch dieser erreichte seine Eltern noch vor der Abfahrt, weil der Zug drei Stunden Verspätung hatte. So haben die Eltern und alle Kinder die Schoa überlebt. Dr. Ma(n)nes ist 1960 in London mit 89 Jahren gestorben.
Literatur:
Dehm, Karl und Heckel, Gottlob: Häusergeschichte der Altstadt Schwabach; Schwabach 1967.
Jüdisches Museum Franken in Schwabach: Manuskript für den Außenrundgang, Fürth 2015.
StAN, Reg. V. Mfr. , K.d.I., Abg. 1932, Judens., Nr. 182I.
BHR Biographisches Portal der Rabbiner- Steinheim-Institut. Ebenda.
Texte zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Schwabach in: https://www.alemannia-judaica.de/schwabach_texte.htm, (aufgerufen 26.05.2021).
StAn. Reg.v. Mfr. , K.d. I. bg. 1968, Judens. 3 u 23. Zur Installation von Löb Wißmann vgl Jeschurun 4 (1858), Nr. 5 vom Februar, S. 273.
http://www.steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/bhr?id=1886. Aufgerufen 26.05.2021.
Schöler, Eugen (Hsg): Historisches Stadtlexikon, Schwabach 2008.