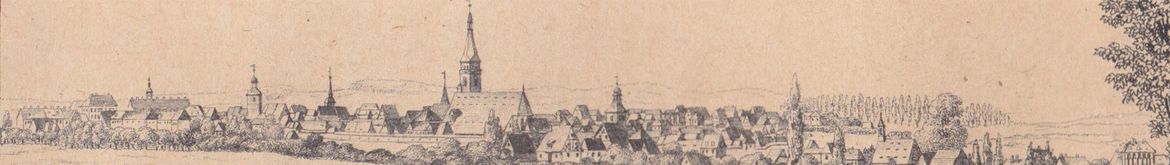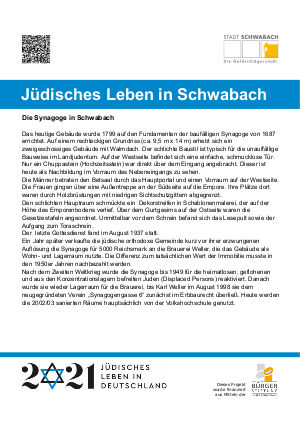Das heutige Gebäude der ehemaligen Synagoge wurde 1799 auf den Fundamenten der älteren baufälligen Synagoge von 1687 errichtet. Gemeint ist mit dem Wort „Synagoge“ ein Raum, in dem sich die jüdische Gemeinde zu Gebet und Belehrung versammelt. Auf einem rechteckigen Grundriss (mit etwa 9,5 m x 14 m) erhebt sich ein zweigeschossiges Gebäude mit einem Walmdach. Insgesamt zeigt sich hier ein schlichter Baustil, der sich unauffällig in die Umgebung eingefügt hat. Der heutige weiße Außenanstrich gibt nicht das ursprüngliche Bild wieder, denn dieser ist in einem rötlich-sandigen Ton gewesen. Diese Bauweise findet sich generell im Ansbacher Landjudentum. Auf der schmalen Westseite befindet sich eine einfache, schmucklose Türöffnung. Nur ein Chuppastein (Hochzeitsstein) in Sternform war direkt über dem Eingang angebracht. Dieser ist heute als Nachbildung im Vorraum des südlichen Nebeneingangs zu sehen.
Der Innenbereich war über zwei separate Zugänge zu erreichen: Es gab einen, über eine kleine Außentreppe speziell für die Frauen am westlichen Ende der südlichen Längswand. Von hieraus erreichten die Frauen die auf beiden Seiten und westlich über dem Vorraum befindlichen Emporen. Dabei mussten sie das Treppenhaus verwenden, das mit einer Zwischenwand von dem Teil des Treppenhaus abgetrennt war, das von den Männern benutzt wurde. Diese betraten die Synagoge durch das Hauptportal auf der Westseite und gelangten so in den abgeteilten Vorraum. Von hier aus stiegen die Männer über wenige drei Stufen in den etwa neun Meter breiten und elf Meter langen Hauptraum hinab , in dem sich die in jeweils drei Blöcken nach Osten auf den Tora-Schrank ausgerichteten Sitzbänke befanden. Die Plätze der Frauen waren durch geschlossene Holzbrüstungen mit niedrigen Sichtschutzgittern vom Männerbetsaal abgetrennt. Die Ausgestaltung des Hauptraumes beschränkte sich auf einen schmalen Dekorstreifen in Schablonenmalerei, der als Gurtgesims auf der Höhe des Emporenbodens angebracht war. Über dem Gurtgesims waren die Gesetzestafeln angeordnet.
Unmittelbar vor dem Schrein befand sich sowohl das Lesepult mit jeweils seitlichem Aufgang als auch der Aufgang zum Tora-Schrein. Gemäß der orthodoxen Liturgie war die Bima (das Lesepult) von der Ostwand abgerückt und befand sich zwischen zwei Säulen, nicht jedoch in der Mitte des Raumes.

| Das Innere der Synagoge 1938 mit Blick auf den Tora-Schrein an der Ostwand. (Foto: Wolfgang Kandel) |
Der letzte Gottesdienst, den die Gemeinde feierte, fand im August 1937 statt. Am 10. August 1938 verkaufte die jüdische Gemeinde kurz vor ihrer erzwungenen Auflösung die Synagoge für 5000 Reichsmark an den Brauereibesitzer Alois Weller. Im Zuge der Restitutionsverfahren in den 1950er Jahren bezahlte er die Differenz zum tatsächlichen Verkaufswert. Die Brauerei ließ das Gebäude zu einem Wohn- und Lagerhaus umbauen. Deshalb wurde das Gebäude in der Reichspogromnacht im November 1938 auch nicht geschändet oder zerstört.
Durch den Umbau erhielt das Gebäude auch die Klappläden, die im Zuge der Restaurierung und Modernisierung im Jahre 2002/03 auch für das Erdgeschoss übernommen wurden. Allerdings hatte man dabei den südlichen Frauenaufgang entfernt und stattdessen den Anbau mit dem heutigen Seiteneingang angefügt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Synagoge vorübergehend bis 1949 für die heimatlosen, geflohenen und aus den Konzentrationslagern befreiten, Juden (Displaced Persons), die vorübergehend nach Schwabach kamen, durch die amerikanische Militärregierung reaktiviert, um dann später wiederum als Lagerraum für die Brauerei verwendet zu werden.
Im August 1998 überließ Karl Weller die Synagoge dem neugegründeten Verein „Synagogengasse 6“ im Erbbaurecht. Heute werden die umfassend sanierten Räume hauptsächlich von der Volkshochschule im Sinne des Wortes „Synagoge“ genutzt, also zur Zusammenkunft und Belehrung.
| 2002 wurde die Synagoge umfassend saniert. Das ursprüngliche Inventar ist nicht mehr erhalten. Auch die Gesetzestafeln an der Ostwand sind eine Nachbildung. Sie wurden gestiftet von dem Ehepaar Nachum und Arje Wissman aus Jerusalem. Er ist ein Nachfahre des vorletzten Schwabacher Rabbiners Loeb Wissmann. (Foto: Ursula Kaiser-Biburger) |
Literatur:
Bezirk Mittelfranken (Hsg): „Der Rabbinatsbezirk Schwabach“ aus der Reihe Franconia Judaica 4 ; Ansbach 2009.
Berger-Dittscheid, Cornelia: Schwabach. Lernmaterial für Fortbildung des JMF. Manuskript 2009.
Dehm, Karl und Heckel, Gottlob: Häusergeschichte der Altstadt Schwabach; Schwabach 1967.
Schöler, Eugen (Hsg.): Historisches Stadtlexikon; Schwabach 2008.